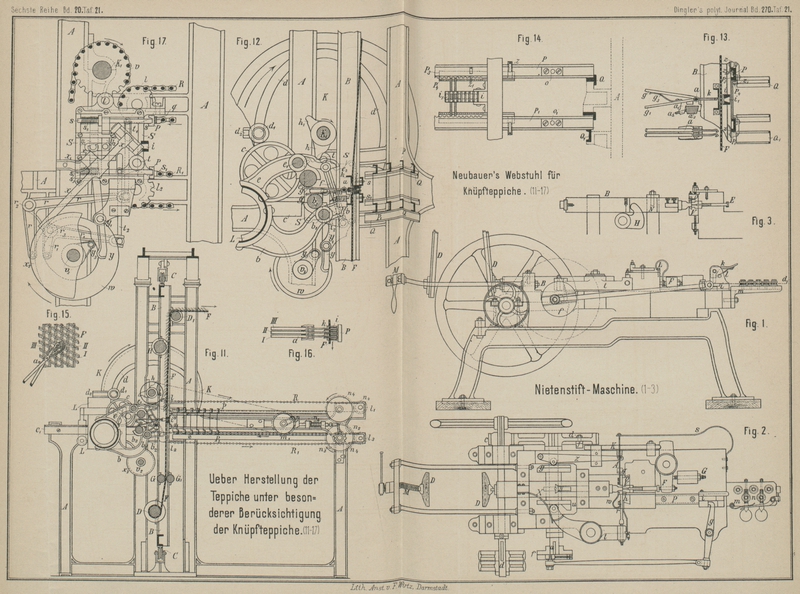| Titel: | Nietenstift-Maschine. |
| Autor: | Pr. |
| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 396 |
| Download: | XML |
Nietenstift-Maschine.
Mit Abbildungen auf Tafel
21.
Nietenstift-Maschine.
Zur Herstellung schwacher Nieten aus Eisenstäben im kalten Zustande dient die
nachfolgend beschriebene Maschine, welche dem Praktischen
Maschinen-Constructeur, 1888 Bd. 21 * S. 51, entnommen ist.Auch Revue generale des Machines-outils, 1888
Bd. 2 * S. 49.
Das auf Gestellfüſsen ruhende Mittelstück enthält die Lager für die erste
Antriebswelle d mit Fest-, Losscheibe und Schwungrad,
welche mittels der Stirnräder c, d die Daumenwelle a bethätigt. Auf dieser ist die Schlitzkurbelscheibe
f für die Stabzuführung, die Kammscheibe u für den Abschneider, die Kammscheibe y für den Einbringer und der Triebdaumen H (Fig. 1, 2 und 3) für die Hammerbewegung
aufgekeilt, während in dem auf der gleichen Welle sitzenden Stirnrade d eine Hubrolle J (Fig. 2) für die
Bewegung des Auswerfers vorgesehen ist.
Die Zuführung des Eisenstabes durch die Lochbüchse h
erfolgt mittels des auf der Führung P gleitenden und
durch Kurbel f, Schubstange und Hebel g hin und her bewegten Schlittenbockes t, welcher den in den Führungsrollen n lagernden Stab mittels eines durch die Feder l gespannten Winkelhebels k im Vorhube klemmt und vorschiebt, im Rückhube hingegen auslöst und den
Stab liegen läſst. Die Länge des herzustellenden Nietstiftes wird durch die
Hubgröſse dieses Klemmbockes i bedingt, während auf die
Stabstärke durch Verstellung der Führungsrollen Rücksicht genommen ist. Um den Stab
im Rückhube des Klemmbockes i festzuhalten und dadurch
die genaue Länge des Nietstiftes zu sichern, klemmt der durch die Feder m gespannte Winkelhebel den zugeführten Eisenstab an
seinem freien Ende gegen eine Nase des Rollenböckchens.
Der durch die Büchse h geschobene Eisenstab spannt die
Federschleife to, während das an dem Hebel t angelenkte
und durch die Kammscheibe u bethätigte Schermesser r ein Stück von der Stablänge abschneidet, welches von
dem durch die Federschlinge s vorgeschobenen
Gegenbacken q gefaſst und im weiteren Vorhube von r genau vor die Oeffnung der Patronenbüchse gebracht
wird, wobei die gespannte Federschleife w den Nietstift
in die Patronenbüchse schiebt, sobald die Pressung der Backen r und q in ihrem Rücklaufe
aufhört.
Um die Auswechselung sowohl der Lochbüchse A, wie der
Patronenbüchse zu erleichtern, sind dieselben in einem stellbaren Schlitten o eingesetzt, welcher auch zugleich die Führungen für
den Scher- und Einbringerbacken r und q enthält.
Der in die Büchse eingesteckte Nietstift stützt sich an dem Widerhalter, welcher sich
wieder an den Hebel F anlegt, dessen Stellung durch die
Schraube G geregelt wird. Nachdem noch durch die auf
den Hebel Z einwirkende Kammscheibe y der Einlegerbacken q
zurückgestellt und der Hebel t mit dem Scherbacken r durch die Blattfeder x
an die Kammscheibe u angelegt worden ist, liegt der
glatte Nietstift unbehindert und frei vorragend aus der Patronenbüchse v.
In diesem Augenblicke verläſst der Triebdaumen H (Fig. 3) in
seiner Linksdrehung am Ende der Berührung den nach links geschobenen Niethammer B, welcher, frei
geworden, vermöge eines durch federnde Bretthölzer D
hervorgebrachten Druckes nach rechts geschnellt wird, wodurch mittels des Stempels
C der Nietkopf mit einem Schlage gebildet wird
(Fig.
1).
Die Schlagkraft der beiden an der Decke befestigten bis 3m langen Bretthölzer D kann durch die
Griffschraube M geregelt werden. Nach beendetem Schlage
verharrt der Niethammer B während einer halben
Umdrehung der Daumenwelle a in der Schlagstellung,
während der Hammer B in der nächstfolgenden
Vierteldrehung zurückgebracht und im Verlaufe der letzten Vierteldrehung in der
gespannten Stellung zurückgehalten wird. Kurz nach Beginn des Hammerrücklaufes
schlägt die im Rade d angebrachte Rolle J an den geführten Stab K,
welcher den Hebel F zu einer kurzen Schwingung zwingt,
vermöge welcher der Widerhalter E den gebildeten
Nietenstift aus der Patronenbüchse wirft. Die Federschlinge L bringt aber sofort sowohl den Widerhalter E
als auch den Hebel F mit der Stange K in die Ruhestellung.
Der Arbeitsvorgang gliedert sich dementsprechend so, daſs während der Schlagstellung
des Hammers B die Stabzuführung in einer halben
Umdrehung der Daumen welle durchgeführt ist, während zum Absehneiden und Einführen
des Stiftes ein Viertel, zum Zurückstellen der Backen r
und q das letzte Viertel einer Umdrehung der Daumen
welle zugewiesen wird,
so zwar, daſs der kurz andauernde freie Schlag in den letzten Abschnitt dieser
Vierteldrehung fällt.Ueber Maschinen zur Herstellung von Nieten, Nägel und Drahtstifte vgl. Bouchart, Delille, 1877 226 * 341. Kohlstadt, 1879 231 * 321. Meyer,
1879. 231 377. H.
Simon, 1879 232 * 402. Geyer, 1879 233 *
449. Malmedie, Schmitz, 1880 236 * 295. Becke,
1881 241 467. Dyson,
Bradley, 1882 243 169. Cremidi, 1882 245 *
251. Koller, Ruch, 1883 247 * 323. Sloan, 1883 250 * 47. Malmedie,
Hiby, 1883 250 378. Opterbeck, Ziegler, 1883 250 549.
Pr.
Tafeln