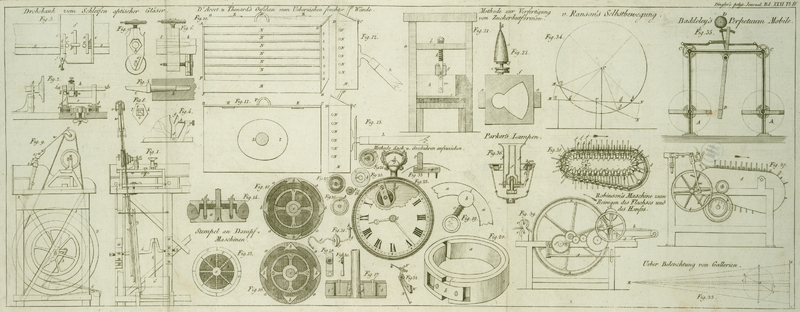| Titel: | Oefchen der HHrn. d'Arcet und Thénard, dessen sie sich zum Ueberziehen feuchter Wände mit einer Wachs-Composition bedienen, um alle Feuchtigkeit von denselben abzuhalten. |
| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. LXXVII., S. 285 |
| Download: | XML |
LXXVII.
Oefchen der HHrn. d'Arcet und Thénard, dessen sie sich zum Ueberziehen
feuchter Waͤnde mit einer Wachs-Composition bedienen, um alle Feuchtigkeit
von denselben abzuhalten.
Nach dem Recueil Industriel. November 1828. S.
205.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
d'Arcet's und Thénard's Oefchen etc.
Der Recueil industriel hat in seinem II. B. S. 117 (und
wir haben aus dem Journ. de Phar. im Polytechn. Journ. B.
XX. S. 280.) Hrn. d'Arcet's und Thénard's Verfahren beschrieben, nach welchemEs unterliegt keinem Zweifel, daß man durch den, a. a. O. angegebenen
Wachs-Ueberzug feuchte Waͤnde troken legen kann, wenn diese
Waͤnde aus schlechten Steinen aufgefuͤhrt wurden, oder, indem
sie in nassem Grunde stehen, durch die Capillar-Attraction Wasser
einsogen und aus der Erde immerdar in die Hoͤhe fuͤhren. Es
gibt aber eine andere Ursache der Feuchtigkeit der Waͤnde, in
Gebaͤuden, die man mit keinem Wachs-Ueberzuge, selbst nicht
mit Staniol-Bekleidung abzuhalten vermag, und diese ist die
Kaͤlte der Mauern bei warmer feuchter Luft. Man sehe nur in gewissen
Kirchen die Marmor-Saͤulen oder den mit Marmor ausgelegten
Fußboden derselben, in großen Gebaͤuden, deren Gaͤnge mit
Marmor- oder geschliffenen Kellheimer-Platten ausgelegt sind,
im hohen Sommer an, wenn entweder ploͤzlich viele Leute sich in
denselben versammeln, oder wenn eine schwuͤle feuchte Luft als
Vorbote eines nahen Regens in dieselben dringt. Die
Marmor-Saͤulen schwizen, daß das Wasser herablaͤuft,
und auf den Marmor-Platten am Fußboden steht das Wasser in Tropfen,
als ob es geregnet haͤtte. Der gemeine Mann, dem dieses
Phaͤnomen nicht entgangen ist, sagt mit Recht: „die Steine
schwizen; es wird bald regnen.“ Dieses, Schwizen der
Marmor-Waͤnde ist ein Beweis, daß die Luft, die dieselben
beruͤhrt, mit sehr vielen Wassertheilchen
geschwaͤngert ist, die zwar in der Luft durch die Waͤrme
derselben noch in luftfoͤrmigem Zustande aufgeloͤst erhalten
werden koͤnnen, die aber, sobald der Luft die Waͤrme, die
diese Wassertheilchen in luftfoͤrmigem Zustande aufgeloͤst
erhaͤlt, durch die Kaͤlte der glatten Marmorwaͤnde
entzogen wird, diese Wassertheilchen in tropfbar fluͤssigem Zustande
fallen laͤßt. Die kalten Marmorwaͤnde, die der sie
beruͤhrenden Luft den Waͤrmestoff immerdar entziehen, werden
daher auch immer naß werden, sobald die Luft Feuchtigkeit enthaͤlt.
Diesen Wasser-Erzeugungs-Proceß sieht man vielleicht nirgendwo
in einem Gebaͤude in Europa schoͤner, als in der Kirche der h.
Wallburga zu Eichstaͤdt, wo an der Marmorwand, die das kuͤhle
Grab dieser heiligen Aebtissinn dekt, das Wasser an derselben immerdar in
Tropfen herabtraͤufelt. Dieses Wasser wird gesammelt, und als
Wallburgis-Oehl als Heilmittel gegen alle Krankheiten in kleinen
Flaͤschchen verkauft: eine Traffik, die dieser Kirche
jaͤhrlich zwischen 42-20,000 fl. traͤgt. Alle Thénard's und
d'Arcet's werden
dem Wasser-Praͤcipitations-Processe an diesem Grabe mit
allen Wachsuͤberzuͤgen kein Ende machen, so lang die Kirche
nicht kaͤlter, und die Gruft und der Stein, der sie dekt, nicht
waͤrmer wird. Alle sehr diken Waͤnde sind kalt, und daher an
ihrer Oberflaͤche feucht, und sogar naß, sobald die Luft, die sie
umgibt, einen gewissen Grad von Temperatur am Thermometer und einen gewissen
Grad von Feuchtigkeit am Hygrometer zeigt, und nicht in einer raschen
Stroͤmung erhalten wird. Die Physiker haben sich, so viel wir wissen,
noch nicht die Muhe gegeben, das Verhaͤltniß der Temperatur einer
Wand zu der Temperatur der von derselben eingeschlossenen Luft und des
Grades der Feuchtigkeit der lezteren, als den drei Bedingungen zur
Wassererzeugung an einer Wand, zu bestimmen: es waͤre indessen eben
so sehr der Muͤhe werth hier den Thaupunkt zu bestimmen, als man ihn
in freier Luft und an den Fensterscheiben durch Daniell's Versuche bereits kennt. Wir
koͤnnten dadurch vielleicht die Aufgabe, zu trokenen Waͤnden
zu gelangen, in einigen schwierigen Faͤllen leichter loͤsen,
denn wir sehen in Pallaͤsten wie in Kerkern und in Kirchen wie in
Schauspielhaͤusern oft das Wasser von den Waͤnden laufen.
Insofern Wachsuͤberzug die Waͤnde glatt macht, muͤssen
sie sogar, unter den eben angegebenen Bedingungen, noch feuchter werden, da
glatte Flaͤchen an einem Koͤrper immer kaͤlter sind,
als rauhe an eben demselben.A. d. U. die Kuppel der Kirche St. Geneviève troken gelegt wurde.
Da dieses Verfahren immer mehr und mehr Anwendung gewinnt und auch zur Auskleidung
von Cisternen, zur Erhaltung von Statuͤen und Basreliefs verwendet wird, so
theilte der Recueil diesen Aufsaz noch ein Mal mit, und
fuͤgte demselben Abbildung und Beschreibung des Oefchens mit, das bei dem
Auftragen dieser Wachs-Composition unentbehrlich ist.
Dieses Oefchen (der Vergolder-Ofen, réchaud du
doreur) ist so eingerichtet, daß das Brenn-Material auf einem
senkrecht stehenden Roste brennt, ungefaͤhr so, wie bei den
Brat-Oefchen und bei dem Oefchen der Siegellak-Fabrikanten. Man
bedient sich desselben, um Flaͤchen damit zu waͤrmen, die senkrecht
stehen oder mehr oder minder gegen den Horizont geneigt sind; auch um die Deke von
Zimmern oder Saͤlen damit zu waͤrmen.
Fig. 10 zeigt
dieses Oefchen von der Vorderseite und im Perspective. Der Dekel, A, B, C, D, wird mittelst des Griffes, P, abgehoben, und dreht sich in den beiden Gewinden, E, E, wie man in Fig. 11 sieht, und in
Fig. 12
und 13 bei,
C.
N, N, N, N, N, N, sind sechs starke Eisendrathe, die die
Kohlen in dem Oefchen zuruͤkhalten. Die Enden derselben stehen auf der rechten Seite der Figur
vor, und man sieht sie in ihrem Durchmesser in den Punkten, N, N, an Fig. 12 und 13. Das Oefchen ist unten
durch das Blech, F, G, H, I, geschlossen, welches
zugleich als Aschenherd, M, fuͤr die
niederfallende Asche dient.
Wenn man sich dieses Oefchens bedienen will, oͤffnet man den Dekel, A, B, C, D, fuͤllt es mit gluͤhenden
Kohlen, schließt den Dekel, und traͤgt es mittelst des Stieles, L, dort hin, wo man es haben will. Dieser Stiel, L, den man in Fig. 12 und 13 sieht, kann
entweder unter einem rechten Winkel auf das Oefchen, wie in Fig. 13, oder unter einem
schiefen, wie in Fig. 12, angebracht seyn, je nachdem es die Arbeit fordert. (Er
wuͤrde sich wohl auch in einer Art Nuß mit einer Stellschraube so anbringen
lassen, daß er nach Belieben gestellt werden kann.)
Fig. 11 zeigt
das Oefchen von hinten. B, C, ist die hintere Linie des
Dekels und, E, E, sind die beiden Gewinde. P, ist der Griff. I, ist
eine kreisfoͤrmige oder elliptische Platte, die die Hand des Arbeiters gegen
die Einwirkung der Hize schuͤzt, wenn er das Oefchen bei dem Griffe umher
traͤgt. I, in Fig. 13, zeigt die Lage
dieser Platte zwischen dem Oefchen und der Hand des Arbeiters.
Man kann in diesem Oefchen Holzkohlen und Kohks brennen. Das Feuer wird, wie
gewoͤhnlich, unterhalten. Bei dem Gebrauche haͤlt man es gegen den
Gegenstand hin, den man damit troknen oder erwaͤrmen will, und faͤhrt
damit hin und her. Die Menge des Brennmaterials, die Entfernung, die mehr oder
minder senkrechte Lage bleibt der Erfahrung des Arbeiters und dem Zweke desselben
uͤberlassen.
Man verfertigt diese Oefchen in verschiedener Groͤße und in verschiedenen
Formen, so wie die Arbeit es erfordert.
In Fig. 10
haͤlt die Linie, A, D, 18 Zoll. Hieraus ergeben
sich die uͤbrigen DimensionenEs scheint uns, daß die Kohlen in diesem Oefchen ohne allen Luftzug nicht
lang genug brennen werden, und daß man durch den Stiel oder auf irgend eine
Weise Luft in denselben schaffen muͤsse.A. d. U..
Tafeln