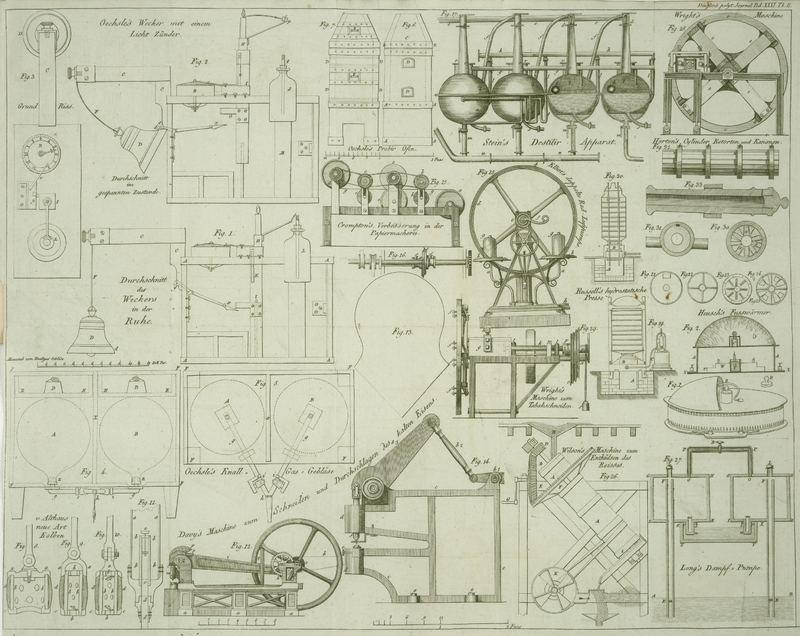| Titel: | Oekonomische Fußwärmer (Chauffrettes de Hollande) in Zimmern, Bureaux, auf Schiffen, in Wagen; von der Erfindung des Hrn. Heusch zu Henri-Capelle. |
| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. XXVIII., S. 99 |
| Download: | XML |
XXVIII.
Oekonomische Fußwaͤrmer (Chauffrettes de Hollande) in Zimmern, Bureaux, auf Schiffen,
in Wagen; von der Erfindung des Hrn. Heusch zu Henri-Capelle.
Aus dem Industriel belge. N. 59. 1828. Im Bulletin des Sciences
technolog. Octbr. 1828. S. 244.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Heusch's oͤkonomische Fußwaͤrmer.
Die hollaͤndische Sitte, ein Kohlen- oder Torf-Beken unter die
Fuͤße zu stellen, und die Nachtheile, die mit dieser gefaͤhrlichen
Vorrichtung verbunden sind, veranlaßten den Verfasser auf eine Verbesserung
derselben zu denken.Die Faulheit, die dem menschlichen Geiste angeboren ist, und die wir aus
Heuchelei gegen uns selbst Gewohnheit nennen, macht uns nicht blos stolz auf
unsere Thorheiten, vergnuͤgt und zufrieden bei dem Elende, das sie
uͤber uns brachte und noch bringt; sie sezt uns sogar, was man von
der Faulheit kaum erwarten sollte, in eine Thaͤtigkeit, die bis an
das Muͤheselige und Laͤcherliche graͤnzt, die das Reich
unserer Thorheiten verewigen und erweitern hilft und zu dem alten Jammer
noch neues Elend, zuweilen sogar mit nicht geringem Aufwande an
Geistes- und Koͤrperkraft, reichlich hinzuthut. So unendlich
die Fortschritte sind, die geistreiche Physiker, gewekt durch das Beispiel
des unsterblichen Rumford, in der Pyrotechnik
seit einem halben Jahrhunderte gemacht haben, so faͤhrt man doch in
demselben Lande, in welchem Rumford seine, fuͤr die Menschheit so
wohlthaͤtigen, Arbeiten begann, noch immer fort, den einzigen wahren
Reichthum dieses Landes jaͤhrlich zu Millionen nicht bloß
unnuͤz, sondern zum Schaden und Verderben der Gesundheit, muthwillig
zu verbrennen, und waͤhrend man in diesem Lande im Winter halb
gebraten wird, ist man in Rumford's Vaterlande und in dem benachbarten
Holland, so mild auch daselbst der Winter ist, in Gefahr zu erfrieren, und
der Englaͤnder und Hollaͤnder ist in kalten
Winter-Tagen bei all seinem Reichthume nicht viel
gemaͤchlicher in seinen reichen Zimmern, als der
Groͤnlaͤnder und Eskimoh in seinem Schneeloche beim kochenden
Thrantopfe. Vergebens hat Franklin an seinem Kamin-Ofen der
Menschheit ein Geschenk hinterlassen, das nur an seinen
Wetter-Ableitern sein Gegenstuͤk findet; es gibt noch zur
Stunde weit weniger Francoline in den Haͤusern, als
Wetter-Ableiter auf den Haͤusern. Die ungeheueren
Kacheloͤfen, die, genau zusammen gerechnet, in einer Stunde mehr
Forstfrevel veruͤben, als alle Holzdiebe in einem Jahre, sind in dem
groͤßten Theile von Deutschland noch ebenso an der
Tages-Ordnung, wie die erbaͤrmlichen Kamine in England und in
Holland und in einem großen Theile Frankreichs. Da man an diesen Kaminen auf
einer Seite friert, und auf der anderen bratet, und nie zu einer behaglichen
warmen Stube gelangt, so gerieth man in England, und noch mehr in dem
kaͤlteren feuchteren Holland, auf die Idee, sich die Theile seines
heiligen Leibes einzeln zu waͤrmen; und so entstanden die
Fußwaͤrmer, die Bauchwaͤrmer, die Bettenwaͤrmer u.s.f.,
bis zu den Nasenwaͤrmern hinauf, als welche man in Holland die
zolllangen Tabakpfeifen fuͤglich betrachten kann. Bluͤhende
Doͤrfer, Markte und Staͤdte wurden durch einen oder den
anderen dieser Waͤrmer wiederholt in Asche gelegt; Hunderte von
Frauen und Maͤdchen wurden und werden noch jezt (erst vor wenigen
Wochen in England eine angesehene Frau) lebendig durch diese
Fußwaͤrmer verbrannt, alle diese Lektionen vermoͤgen nichts
gegen die Faulheit des menschlichen Geistes: es bleibt nicht nur beim Alten,
sondern man macht sogar daß Alte, (wie, bei Kaͤstnern, der
Italiaͤner zu Leipzig das Leiden Christi) „auf eine neue
Manier.“ Eine solche neue Manier des alten Uebels ist auch
gegenwaͤrtiger Fußwaͤrmer, den wir nur als
Warnungs-Tafel und als Beispiel der vielfaͤltigen Verirrungen
des menschlichen Geistes hier auffuͤhrten.Als Warnungs-Tafel, indem die Fußwaͤrmer, nicht bloß noch den
Erfahrungen aller Aerzte, sondern selbst nach dem Gefuͤhle des
gesunden Menschen-Verstandes, die Quelle zahlloser Krankheiten sind. Seit
den Zeiten des unsterblichen Boerhaave haben die achtbaren
hollaͤndischen Aerzte ihren diken Landsmaͤnninnen gezeigt und
bewiesen, daß so viele ihrer Krankheiten, ihrer Ausschlaͤge und
Geschwuͤre an den Fuͤßen, ihre Krampfadern an denselben (die
sogenannten Kinderfuͤße), ihr laͤstiger und garstiger weißer
Fluß, ihre Muttervorfaͤlle und Krankheiten an der Baͤrmutter
vorzuͤglich von diesen ungluͤklichen Fußwaͤrmern
herruͤhren, die die Temperatur an denselben erhoͤhen, den
Zufluß der Saͤfte dahin und die Reizbarkeit und Empfindlichkeit an
den Muskeln und Nerven dieser Theile krankhaft vermehren etc. Alles war
bisher vergebens und in den Wind gesprochen. Da Hr. Heusch dieses alte Leiden der guten Hollaͤnderinnen auf
eine neue Manier eingerichtet hat, die die verderblichen Folgen theilweise
angebrachter Waͤrme noch durch die nachtheiligen erschlaffenden
Einfluͤsse warmer Wasserdaͤmpfe erhoͤht, so steht, zu
erwarten, daß die Folgen dieser verbesserten Fußwaͤrmer sich bald so
kraͤftig an den Individuen, die sich derselben bedienen,
aͤußern werden, daß diese sich derselben nicht gar lang werden
bedienen koͤnnen; denn im Grabe sind Fußwaͤrmer hoͤchst
uͤberfluͤssig.A. d. U.
Man mag diese Beken mit Holzkohlen oder mit Torf heizen, so hat man lang zu thun, bis
das Brenn-Material gehoͤrig brennt; man hat Muͤhe es in Gluth
zu erhalten; die Waͤrme ist nicht gleichfoͤrmig; die Zimmer werden
dadurch verunreinigt, und selbst die Gefahr bei dem Gebrauche derselben ist nicht
unbedeutend.
Fig. 1 und
2. zeigt
diesen verbesserten Fußwaͤrmer.
A, ist eine ovale Buͤchse aus Eisenblech mit
Loͤchern versehen, damit die Luft freien Zutritt in das Innere derselben
gewinnt. z, ist ein Henkel mit einem Gewinde, um diese
Buͤchse von einem Orte zu dem anderen bequem tragen zu koͤnnen. y, y, y, sind drei kleine Zapfen, zwei vorwaͤrts,
einer ruͤkwaͤrts, jeder mit einem Loche um eiserne Stifte
durchzuschieben, die an Kettchen haͤngen, und wodurch die Buͤchse auf
ihrem Boden befestigt wird. X, ist der Boden der Lampe,
w, mit einem Falze und einem schwimmenden Dochte,
v; ein Reif, u, faßt
dasjenige auf, was allenfalls aus der Lampe verschuͤttet wird.
Diese Lampe, die noch uͤberdieß zwei Ohren und einen Dekel hat, ist so
vorgerichtet, daß die Luft freien Zutritt zu derselben hat und der Docht immer in
der Mitte schwimmt.
B, ist eine horizontale Scheidewand, die als Boden
fuͤr das kleine Beken dient, welches mit kaltem Wasser gefuͤllt
wird.
C, Roͤhre dieses Bekens, durch welches dasselbe
mit Wasser gefuͤllt wird. Diese Roͤhre ist unten mit kleinen
Loͤchern, und oben mit einem Dekel versehen, der etwas weiter ist, um zu
hindern, daß das Wasser nicht uͤber den achtzigsten Grad gehizt wird. Sie ist
uͤberdieß noch mit einer anderen etwas hoͤheren Roͤhre umgeben,
damit auch nicht die mindeste Feuchtigkeit dort hin gelangt, wo man die Fuͤße
hinzustellen hat.
D, eine Huͤlle aus Maroquin zur Aufnahme der
Fuͤße. Sie ist mit Pelz gefuͤttert, und am Rande der Stelle, auf
welche man die Fuͤße sezt, mittelst kleiner Stifte befestigt, die in
Loͤcher passen, mit welchen dieser Rand versehen ist.
E, Dekel, zum Ausloͤschen der Lampe.
Ehe man die Lampe anzuͤndet, fuͤllt man das Beken zur Haͤlfte
mit Wasser, und wenn die Lampe nur acht Minuten lang brennt, wird das Wasser bereits
heiß genug geworden seyn, um die Fuͤße zu waͤrmen. Die Temperatur wird
nach und nach bis auf 80° steigen.
Je nachdem man mehr oder minder warm haben will, darf man die Lampe nur hoͤher
oder tiefer stellen.
Auf Reisen in Wagen oder Schiffen nimmt man statt der Lampe eine dike Wachskerze.
So wie das Wasser verduͤnstet, muß man nach und nach frisches zusezen. Die
Lampe wird mit Weingeist unterhalten, der („in Holland und
Frankreich“), wie Herr Derosne der aͤltere in seinen Versuchen
am Sparheerde erwiesen hat, nicht theurer kommt, als Holzkohle.
Tafeln